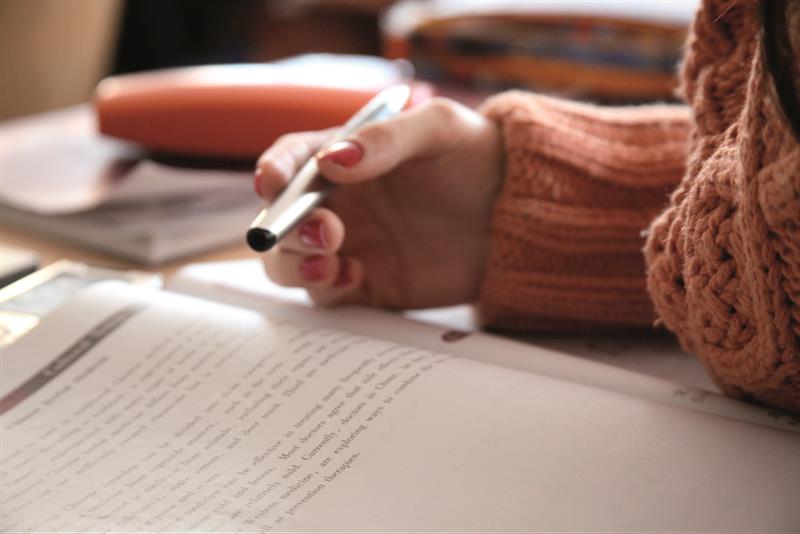
Ein Erfahrungsbericht von accadis-Doktorandin Maria Ratz
Per Definition versteht man unter einer Promotion den wissenschaftlichen Prozess bzw. die wissenschaftliche Arbeit, mit dem bzw. der man den Doktorgrad erlangt. Und doch können sich nur wenige Personen in meinem Umkreis etwas darunter vorstellen, wenn ich mal wieder gefragt werde: „Was machst du eigentlich beruflich oder studierst du immer noch?“ Die Antwort darauf fällt mir manchmal gar nicht so leicht. Zum einen ist die Promotion natürlich ein Studium und ich bin als Promotionsstudentin eingeschrieben. Aber dennoch fühlt es sich größtenteils eher wie arbeiten an, zumindest bei mir, da ich in voll berufstätig bin – dies trifft aus meiner Erfahrung jedoch auf viele Doktoranden zu.
Ein Promotionsprogramm „aus der Ferne“

In meinem Fall heißt an der accadis Hochschule zu promovieren, in das Kooperationsprogramm mit der Newcastle Business School der Northumbria University integriert zu sein und dort das dreijährige Part-time-Programm „Doctor of Business Administration (DBA)“ zu absolvieren. An dem Programm gefällt mir die klare Struktur besonders gut: Blockeinheiten zu Beginn, Meilensteine, monatliche Abstimmungen mit dem Betreuer – das erleichtert den Prozess und man erhält regelmäßig Feedback, ob man sich noch auf dem richtigen Weg befindet. Dies ist besonders wichtig, da der Großteil der Promotionsstudierenden, die mit mir in dem Programm sind, eben auch berufstätig ist. Ich z. B. arbeite als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der accadis Hochschule und unterstütze deren Hochschulmarketing. Sicherlich erleichtert es meine Promotion enorm, dass ich durch meine Arbeit im akademischen Bereich viel näher an den wissenschaftlichen Tätigkeiten dran bin als in einem Job in anderen Wirtschaftsbereichen. Gerade die Unterstützung durch die accadis Hochschule vor Ort ist sehr wichtig für mich und erleichtert es, ein Doktoranden-Programm „aus der Ferne“ zu belegen. Nichtsdestotrotz kenne ich viele Promovierende, die neben ihrer Tätigkeit in einem Unternehmen die Doktorarbeit schreiben.
Eigenes Forschungsgebiet finden

In mir reifte die Idee, zu promovieren bereits während meines MBA-Studiums und auch mein vorhergehender Arbeitgeber hatte mir eine berufsbegleitende Promotion direkt bei der Einstellung vorgeschlagen. Thematisch war für mich sehr früh klar, dass ich an meine Masterarbeit anknüpfen wollte. In dieser Thesis hatte ich viele spannende Ideen eingebracht, die ich aufgrund der Ausrichtung der Arbeit nicht intensiv darstellen konnte. Während ich also damals über Fundraising als neues Modell für Sportvereine schrieb, spezialisiere ich mich in der Promotion auf Crowdfunding für Profi-Fußballvereine. Aus meiner Sicht ist die Themenwahl einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, um die Doktorarbeit überhaupt und im vorgesehenen Zeitrahmen fertigzustellen. Man muss sich insgesamt mehr als drei Jahre mit dem Thema beschäftigen, es sich zu eigen machen, und deshalb sollte man auf jeden Fall Spaß daran haben. Früher oder später mag man keine Artikel mehr zu seiner Fragestellung lesen, und dennoch kommt man nicht darum herum. Die Leidenschaft sowie die intrinsische Motivation für das eigene Thema sind unabdingbar für den Prozess. Daher ist meine Empfehlung an alle, die promovieren wollen: vor dem Start intensiv Gedanken zum Thema machen, ein paar Wochen am Stück täglich damit auseinandersetzen (beispielsweise durch Lesen von Artikeln, Büchern und Blogs) und nach dieser Zeit entscheiden, ob man die Idee weiterverfolgen will. Lässt das Interesse bereits nach einigen Tagen nach oder ergeben sich nicht ständig neue, fesselnde Fragestellungen, hat man das eigene Forschungsgebiet vielleicht noch nicht gefunden.
Alltag eines Doktoranden
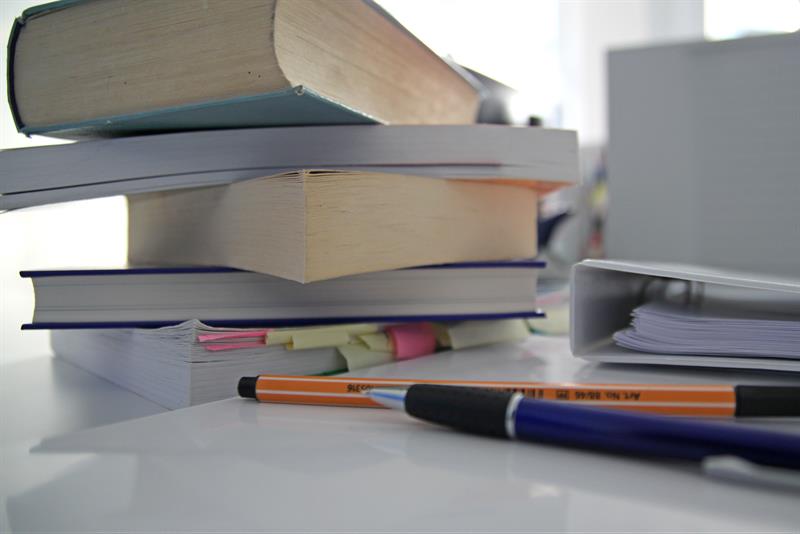
Aber was macht man nun tatsächlich während der Promotion? Besonders im ersten Jahr heißt es: lesen, lesen und noch mehr lesen. Eine ausführliche Literatur-Recherche ist der Ausgangspunkt aller Doktorarbeiten. Nur so lassen sich Lücken im Forschungsstand identifizieren, die zu der eigentlichen Fragestellung der eigenen Arbeit führen, und entsprechend geeignete methodische Ansätze finden. Ein kleiner Tipp am Rande: Am besten geht man systematisch vor und notiert sich, wo und mit welchen Schlagwörtern man nach Artikeln gesucht hat und was einem aufgefallen ist. Zudem macht man sich zu jeder Lektüre ein paar inhaltliche Notizen. Literaturverwaltungsprogramme sind eine enorme technische Unterstützung, wenn sie vollständig, von Anfang an und kontinuierlich in den Prozess integriert sind. Sie können einen aufgrund ihrer Eigenheiten aber auch an den Rand des Wahnsinns treiben. Nach wie vor stehe ich mit Endnote auf Kriegsfuß, aber dieser Kampf zahlt sich spätestens bei der Zusammenstellung des Literaturverzeichnisses aus – so zumindest meine Hoffnung.
Der empirische Teil
Je nach Ausrichtung der eigenen Arbeit – ob quantitativ oder qualitativ – heißt es dann im zweiten Jahr, die empirische Erhebung vorzubereiten und durchzuführen. Das können Interviews, Fragebögen, Beobachtungen oder andere Forschungsmethoden sein. Diese Ansätze im Detail aufzuschlüsseln und den Prozess darzustellen, würde hier den Rahmen sprengen. Aber es ist auf jeden Fall viel Aufwand – Bürokratie wie in meinem Fall die Genehmigung durch die Ethik-Kommission der Northumbria University – eingeschlossen. Die Datenerhebung entschädigt aber für den bis dato eher administrativen und theorie-lastigen Prozess der Promotion.
Von Fußballclubs und -Fans

Ich habe das große Glück, für meine Doktorarbeit Gespräche mit Fußballclub-Vertretern zu führen, Fans zu befragen und deren Meinungen miteinander zu vergleichen. Es ist unglaublich spannend, in die verschiedenen Vereine hineinschauen zu dürfen und sich zu relevanten Fragestellungen auszutauschen. Gedanken über die Zukunft der 50+1 Regel, die Finanzierung von Spielertransfers sowie Infrastrukturprojekten, die Aufrechterhaltung von Fanbeziehungen und darüber hinaus die Einbindung der Fans in die Vereinsfinanzierung sind Beispiele für Themen, die ich aktuell mit Vertretern der Fußballvereine und Fanclubs diskutiere. Allein inhaltlich lohnt sich für mich die Promotion. Das Thema sollte den Promovierenden wirklich interessieren. Mittlerweile habe ich über 20 Stunden Interviewmaterial gesammelt; einige Gespräche stehen noch aus. Geduld und Ausdauer sind nach dieser Phase für die Datenauswertung nötig. Besonders Interviews können einen Stolperstein darstellen, wenn man bedenkt, dass die Transkription, d. h. das Abtippen der Aufnahme eines 60-minütigen Interviews ca. das Sieben- bis Achtfache der Zeit benötigt.
Noch mehr Input: Konferenzen und Workshops

Auch die Teilnahme an Konferenzen und Doktoranden-Workshops leistet einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zum Doktortitel. Auf diesen Veranstaltungen kann man zum einen sein eigenes Thema vorstellen, mit anderen Wissenschaftlern darüber diskutieren und somit von außen Feedback bekommen. Zum anderen eignen sich Konferenzen und Tagungen zum Netzwerken, um mit den wichtigen Personen des jeweiligen Forschungsbereichs in Kontakt zu kommen. Der ein oder andere hat vielleicht bei Facebook mitbekommen, dass das accadis-Forschungsteam sehr erfolgreich an Konferenzen teilnimmt. Um auf den internationalen Veranstaltungen die eigenen Forschungsthemen präsentieren zu dürfen, reicht man zuvor Paper oder Abstracts ein, die im Idealfall durch ein Komitee akzeptiert werden. Für meine Doktorarbeit finde ich diesen Prozess besonders wertvoll, da man festgelegte Deadlines hat, zu denen man etwas aufbereiten muss. Außerdem sind Konferenzbeiträge in Umfang und Zeit limitiert, sodass man das eigene Thema präzise und verständlich präsentieren muss. Wie sich die Datenauswertung und das Verfassen der Thesis gestalten, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht aus erster Hand berichten. Das hole ich in einigen Monaten nach, wenn ich mich im dritten Jahr befinde.
Doch zuerst: Professoren befragen
Generell sollte sich jeder, der mit dem Gedanken spielt zu promovieren, mit den Professoren austauschen und überlegen, wie man es gemeinsam angehen kann. Vor dem Start des Promotionsstudiums bewirbt man sich, indem man ein Exposé zum Thema einreicht. Zuvor sollte man auf jeden Fall mit einem Professor der Hochschule sprechen, um thematisch und organisatorisch den Rahmen abzustecken. Dazu aber gerne an anderer Stelle mehr!
Maria Ratz
Doktorandin accadis Hochschule Bad Homburg